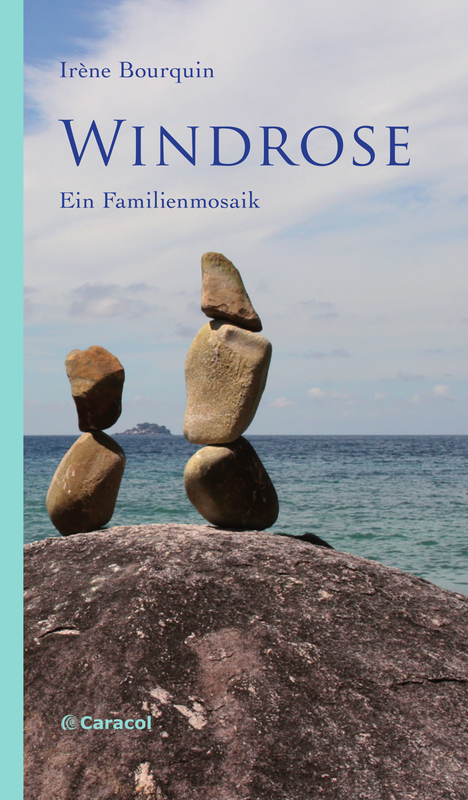Windrose
Windrose Ein Familienmosaik,
Caracol Verlag, Reihe Caracol Prosa, Band 7, Warth 2021, 104 Seiten.
Das Mosaik aus kurzen Prosatexten erzählt die Geschichte(n) einer Familie: Schicksale in der Heimat und das fragile «Glück in der Ferne», vom Jura bis in die Ostschweiz, von Zürich bis Paris und Oslo, Yokohama bis New York, von der Bretagne bis nach Indien. Drei Generationen treten auf, ein Jahrhundert vergeht, doch die einzelnen Lebensläufe werden im Zeitraffer geschildert, sind Mosaiksteine im Porträt der Familie. Wie die Farben in einem Mosaik erscheinen viele Figuren mehrmals, in wechselnden Konstellationen, und auch die Zeit ist nicht linear, sondern setzt sich als Mosaik zusammen.
Die erzählten Schicksale berühren mit erstaunlichen Wendungen, tragischen Ereignissen, aber auch heiteren Episoden: die frohe Prophezeiung einer Wahrsagerin, die sich erfüllt; ein Familientreffen, bald gefolgt von Unglücksfällen; Auswanderung und Rückwanderung. Da sind die Grosseltern, beide aus Schweizer Kaufmannsfamilien, die in Japan mit ihrer zweijährigen Tochter das katastrophale Erdbeben von 1923 knapp überleben. Der Zweite Weltkrieg, mit dem auch die Geschichte eines Paars beginnt, spiegelt sich in den Kapiteln «Heimatfront» und «Grenzerfahrung». Ein Onkel wandert aus nach Paris, später nach Amerika. Sein unfreiwilliges Outing ist in den frühen 50er Jahren eine Bewährungsprobe für die Familie. «Zwillingslos» berichtet von Grossonkeln: in der Jugend unzertrennlich – später ausgewandert, der eine nach Osten, der andere nach Westen – im Alter unvereinbar.
Das Ganze bietet eine abwechslungsreiche, farbige Lektüre und es lohnt sich, auch jeden einzelnen Mosaikstein genauer zu betrachten.
Das Buch ist beim Verlag erhältlich.
Textproben
Paradiesvogel
Die ältere Schwester der Grossmutter hatte vier Kinder, darunter Zwillingstöchter, eine blond, die andere dunkel. Die Blonde heiratete einen Bauernsohn und zog auf den Hof. Die Dunkle war Künstlerin. Sie lebte in Paris, wo sie in einem alten Haus – Klo eine Treppe höher, auf dem Flur – ihr Atelier hatte. Auf ihren Bildern leuchteten, wogten, wanden sich Farben und Formen, die an Meeresfauna erinnerten, an Muscheln, Korallen, geheimnisvolle Wasserwesen. Das Tauchen habe sie dazu inspiriert, erklärte sie. Diesen Satz gehört zu haben, waren ihre Besucherinnen, die Cousine aus Zürich und deren Tochter, sich sicher. Die Mutter erzählte es auch ihrem kunstaffinen Bruder, in dessen Häuschen in der Vorstadt sie wohnten. Dort verkehrten viele befreundete Künstler – einer davon, ein Maler, der später berühmt werden sollte, warf sich im Scherz mit einer Rose in der Hand vor der halbwüchsigen Tochter auf die Knie. Das Mädchen war geniert, zumal schon der Familiencoiffeur in Zürich, ein bekannter Meister seines Fachs und Freizeitmaler, sie hatte porträtieren wollen.
Die Malerin aber wollte später nichts mehr wissen von der angeblichen Inspiration aus dem Meer. – Anlässlich der Vernissage ihrer Ausstellung in der städtischen Galerie zum Strauhof erschien auch der Zürcher Stadtpräsident, was der Familie Eindruck machte. Die Künstlerin war aus dem Bürgertum ausgeschert und noch dazu blutjung Mutter geworden; den Vater des Kindes verschwieg sie. Der Paradiesvogel hatte es nun doch zu öffentlicher Anerkennung gebracht. In deren Abglanz sonnte sich an diesem Abend auch die Familie.
Aber die Malerin schlug in der Mitte ihres Lebens einen anderen Weg ein: Sie ging nach Indien und schloss sich in Kerala einer spirituellen Gemeinschaft an. Deren Führer sei kein Guru, sondern ein Philosoph, betonte sie. Auf ihren indischen Aquatinten wucherte dunkel der Urwald, glitten Kähne über Flüsse, sassen bunte Papageien im Geäst.
Als die indisch gewordene Künstlerin ihre Schweizer Familie besuchte, stellte sich ein ungewohntes Problem: Sie war jetzt überzeugte Vegetarierin – eine exotische Herausforderung für die bürgerliche Verwandtschaft, damals, in den 70er Jahren. Wie konnte man einen seltenen Gast würdig bewirten ohne Fleisch? [ … ]
Autopilot
Während der Prüfling sich angestrengt auf den Stadtverkehr konzentrierte – Blinken, Hupen, Spurwechsel, Rotlicht! –, warf der Experte auf dem Beifahrersitz einen Blick in die Unterlagen und bemerkte: «Hier steht: Muss Brille tragen!» Der Prüfling erschrak, fast hätte er eine Frau mit Kinderwagen gestreift. Vor zehn Tagen erst hatte ihm der Augenarzt eine Brille verschrieben wegen seiner Kurzsichtigkeit. Die Brille steckte vergessen in der Jackentasche. Trotzdem bestand er die Fahrprüfung.
In seinem rechtsgesteuerten MG sass er immer mit Brille. Er war ein rassiger Autopilot, der sich gern den Fahrtwind um die Ohren sausen liess. Die Hühner flatterten gackernd auf, wenn er, Student der Jurisprudenz, in knapp zwei Stunden über Land von Zürich nach Lausanne raste, wo einzelne Vorlesungen in Forensik zu besuchen waren.
Das Dach offen, die Seitenfenster heruntergekurbelt: ausgerüstet mit kreisrunden Schutzbrillen und ledernen Sturmhauben, brausten später die Eltern über die Schweizer Pässe – als Passfahren noch ein harmloses Sonntagsvergnügen war, auf schmalen Strassen, deren Serpentinen der Vater schon von Velotouren kannte.
[ … ]
Schockwellen
«Die Schweizer sind so sauber, dass sie das Geschirr spülen, bevor sie es in die Abwaschmaschine stellen», bemerkte die Besucherin aus Belgien erstaunt. Sie selbst eilte regelmässig in die Messe und ging zur Beichte, um ihre Seele zu reinigen.
Die Belgierin war eine Tochter von Geschäftsfreunden des Grossvaters. Die Familien kannten sich schon ein halbes Jahrhundert; man besuchte sich gegenseitig. Beide Söhne des Duke hatten, wie es in den Familien von Kaufleuten üblich war, in jungen Jahren einige Zeit im Ausland verbracht, auch in Belgien, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern.
Doch nun, im Alter, in der Rückschau, kam es zu bitteren Vorwürfen: Sie sei ledig geblieben, habe ihr Leben verwartet und vertan – während ihre Schwester heiratete und fünf Kinder bekam –, ledig geblieben, weil ihr niemand die Wahrheit gesagt habe, klagte die Belgierin. Als junges Mädchen hatte sie sich in den Jüngsten des Duke verliebt. Damals, noch vor Paris, nahm dieser teil am Leben der bürgerlichen Gesellschaft, tanzte auf Bällen, gefiel den Frauen, flirtete gar mit weiblichen Wesen – soziale Mimikry. Er war ein guter Tänzer, charmanter Unterhalter. «Heikel wurde es», erzählte der Onkel Jahrzehnte später seiner Lieblingsnichte, «wenn eine erhitzte Tanzpartnerin auf den Balkon, die Terrasse hinaustreten wollte, wo schon andere Paare standen, eng umschlungen. – Aber ich habe nie eine Frau geküsst.»
[ … ]
Rezensionen
[…] Mit verhaltener Ironie erzählt Irène Bourquin in «Windrose» von grossen und kleinen Lieben, von Zufällen, Unfällen, Glücksfällen, von Reisen, Auswanderungen, Rückwanderungen, von Schicksalsschlägen und harmlosen Zwischenfällen. Jede Geschichte bringt eine unerwartete Wendung, eine überraschende Erkenntnis, endet in Schmunzeln oder Nachdenklichkeit. Jeder Text steht für sich; zufällig, so scheint es im ersten Moment, reiht er sich an den vorangegangenen. Doch jeder ist Teil eines Ganzen, denn Steinchen um Steinchen baut Irène Bourquin Überliefertes und Erinnertes auf unterhaltsame und scharfsinnige Weise zusammen. […]
Die Lebenswege von drei Generationen kreuzen sich in diesen Geschichten, und aus Irène Bourquins kurzen, polierten Prosatexten formt sich das Bild einer Schweizer Familie im 20. Jahrhundert. So sehr deren Mitglieder durch ihre Individualität und manchmal auch Eigenwilligkeit bestechen, so einmalig der überlieferte Austausch zwischen ihnen ist, stehen sie doch auch stellvertretend für eine Epoche und eine Gesellschaft, auf die Irène Bourquin mit liebevoller Gelassenheit zurückblickt. […] Mit sprachlicher Finesse erzeugt Irène Bourquin in «Windrose» Geschichte um Geschichte ein Netz von Bezügen, das den Leser umgarnt, mit Hinweisen und Andeutungen in Bann hält und doch so subtil ist, dass man auf der letzten Seite unweigerlich den Wunsch verspürt, nochmals von vorne zu beginnen.
Gabrielle Alioth in: EXIL PEN NEWSLETTER, 19. Dezember 2021